Debatte um neue Mittelstreckenraketen
Konzeptioneller Hintergrund und Folgen für die europäische Sicherheit - von Wolfgang Richter
Wolfgang Richter - Bildquelle: Zebis
Das FES Regionalbüro für Zusammenarbeit und Frieden in Europa hat eine Publikation von Wolfgang Richter veröffentlicht, die sich mit den Hintergründen der geplanten Stationierung amerikanischer landgestützter Raketen mittlerer Reichweite in Deutschland im Jahr 2026 befasst. Das Dokument behandelt die geplante Stationierung von US-amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland ab 2026, eine Entscheidung, die während des NATO-Gipfels in Washington im Juli 2024 bekannt gegeben wurde. Diese Maßnahme, die auf die sicherheitspolitische Lage in Europa, insbesondere auf die Bedrohung durch Russland, reagiert, hat das Potenzial, das strategische Gleichgewicht zwischen den USA und Russland zu verändern. Die Entscheidung könnte die Spannungen zwischen NATO und Russland weiter verschärfen und Auswirkungen auf die nukleare Rüstungskontrolle und die Sicherheit Deutschlands haben. Es werden verschiedene technische, militärische, bündnispolitische und innenpolitische Aspekte sowie mögliche Konsequenzen für die europäische Sicherheit beleuchtet.
Wolfgang Richter ist Oberst a. D., war Leitender Militärberater in den deutschen VN- und OSZE-Vertretungen und arbeitet jetzt als Associate Fellow beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP). Er beschäftigt sich u. a. mit der Europäischen Sicherheitsordnung und der stabilisierenden Rolle der Rüstungskontrolle.
Helmut Schmidt zur Stationierung landgestützter Raketen
„Landgestützte Raketen gehören nach Alaska, Labrador, Grönland oder in die Wüsten Libyens oder Vorderasiens, keineswegs aber in dicht besiedelte Gebiete; sie sind Anziehungspunkte für die nuklearen Raketen des Gegners. Alles, was Feuer auf sich zieht, ist für Staaten mit hoher Bevölkerungsdichte oder kleiner Fläche unerwünscht.“

Helmut Schmidt
Iskander in Kaliningrad
Zur Vorgeschichte eines fragwürdigen Arguments
Kritiker der geplanten Stationierung neuer Mittelstreckenraketen wird entgegengehalten, dass Deutschland schon lange durch russische Iskander-Raketen in der Exklave Kaliningrad bedroht werde. Die neuen US-Raketen seien daher lediglich eine Antwort auf diese Bedrohung.
Es lohnt daher, einen Blick auf die Vorgeschichte zu werfen. Diese reicht mindestens bis in das Jahr 2008 zurück. Damals drohte Russland erstmals, Iskander-Raketen mit einer Reichweite bis zu 500 km in der Region Kaliningrad aufzustellen – wenn die USA nicht von ihren Plänen abrücken würden, ein Raketenabwehrsystem in Tschechien und Polen zu errichten.
Mit diesem Raketenabwehrsystem sollten angeblich Interkontinental-Raketen aus dem Iran abgefangen werden. Russland interpretierte das Vorhaben demgegenüber als gegen sich gerichtet – als Gefährdung ihrer strategischen atomaren Zweitschlagfähigkeit.
In 2009 ließ US-Präsident Obama nach seinem Amtsantritt die Raketenabwehr-Pläne überprüfen und rückte von dem ursprünglichen Konzept ab. Zunächst sah es aus, als sei das ganze Projekt einer Raketenabwehr in Mitteleuropa damit erledigt. Russland verkündete unter diesem Eindruck, dass es auf die Stationierung von Iskander-Raketen in Kaliningrad verzichten werde.
Im November 2010 beschloss dann die NATO auf Bestreben der USA , ein Raketenabwehrsystem gegen Kurz- und Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von bis zu 3.000 km zu erreichten. Zur Begründung diente erneut die Gefährdung aus dem Iran. Russland wurde zur Kooperation eingeladen.
Im November erklärte die russische Seite die Kooperationsgespräche für gescheitert, weil es keinen echten Willen zur Kooperation auf Seiten der NATO gebe – was diese ihrerseits bestritt. Russland drohte erneut, Iskander-Raketen in Kaliningrad zu stationieren.
Auf dem NATO-Gipfel im Mai 2012 wurde dann der Startschuss für den Aufbau des Raketenabwehrsystems gegeben. Russische Ankündigungen von Gegenmaßnahmen bis hin zu Drohungen mit einem Erstschlag gegen NATO-Einrichtungen wurden nicht ernst genommen.
In 2016 wurde die erste Raketenabwehr der NATO in Rumänien in Betrieb genommen. Während die NATO betonte, dass das System nicht gegen Russland gerichtet sei, sah es die russische Seite „zu 1.000 Prozent gegen uns gerichtet“ und kündigte wiederum Gegenmaßnahmen an, darunter Iskander-Raketen in der Exklave Kaliningrad.
Im Mai 2018 wurde dann bekannt, dass Russland tatsächlich mit der dauerhaften Stationierung von Iskander-Raketen begonnen hatte. In deutschen Zeitungen war von „einem Ende des Versteckspiels“ der Russen die Rede und einer erwarteten Reaktion auf die Verlegung von vier Nato-Bataillonen in die baltischen Staaten und nach Polen in 2017. Der Zusammenhang mit der Raketenabwehr blieb demgegenüber unerwähnt.
Die Iskander-Raketen wurden auf westlicher Seite zwar als qualitativ neue Bedrohung gesehen, anfänglich aber nicht als Verletzung des INF-Vertrages über das Verbot von (landgestützten) Mittelstreckenraketen mit Reichweiten von über 500 bis 5.000 km. Es gab keine Zweifel daran, dass die aufgestellten Iskander-Systeme lediglich eine Reichweite von 500 km haben würden.
Überraschend kündigten die USA unter dem neuen Präsidenten Trump im Herbst 2018 dann jedoch an, dass sie den INF-Vertrag in 2019 nicht verlängern, sondern auslaufen lassen würden. Begründet wurde dies damit, dass Russland mit einem neuen Iskander-Typ (SSC-8 bzw. 9M729), der eine Reichweite von bis zu 1.500 km besitze, den INF-Vertrag verletzt habe.
Erste vage Vorwürfe in dieser Richtung hatten die USA schon 2014 erhoben, wobei zunächst andere Raketen genannt wurden. Umgekehrt hatte Russland damals erstmals den Vorwurf erhoben, dass das geplante Raketenabwehrsystem in Rumänien und Polen (Tschechien war 2011 ausgestiegen) mit der universellen Raketenstartanlage MK-41 nicht nur Abwehrraketen, sondern auch Marschflugkörper mit Mittelstrecken-Reichweiten verschießen könne – was den INF-Vertrag verletze.
Während die russischen Vorwürfe im Westen so gut wie keine Resonanz fanden, herrschten auch gegenüber den amerikanischen Vorwürfen anfangs offene Zweifel. Gerade in Deutschland gab es über die politischen Lager hinweg das große Interesse, den INF-Vertrag zu erhalten und nicht in ein neues gefährliches Wettrüsten in diesem Bereich einzutreten. Von der Bundesregierung, die von Trumps Entscheidung kalt erwischt, wurde noch der Versuch unternommen, den Vertrag zu retten.
Nach dem vergeblichen Bemühen drehten die widerstrebenden Europäer (was nicht alle waren) dann bei und stellten sich hinter die Kündigung, offenbar um die ohnehin strapazierten Beziehung zum unberechenbaren Trump nicht weiter zu belasten.
Harte Beweise für die russischen Vertragsverletzungen gab es zwar nicht, man behalf sich aber mit Erklärungen wie der folgenden: „Die spärlich verfügbaren Informationen schließen jedoch einen Verstoß mitnichten aus. Zum einen legt die Vehemenz, mit der die USA die Vorwürfe nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch bei NATO-Gipfeln und in Sitzungen der Speziellen Verifikationskommission (SVC), einem Organ des INF-Vertrages, vorgetragen haben, nahe, dass drückende nachrichtendienstliche Beweise vorliegen, welche aber selbst nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. (…) Dass sich die amerikanischen Verbündeten geschlossen hinter den Vorwurf stellten, ohne schlüssige Beweise vorgelegt bekommen zu haben, ist eher unwahrscheinlich.“
Die Vehemenz der USA, die von den europäischen Iskander selbst gar nicht bedroht waren, hatte tatsächlich aber einen anderen Grund: China. „US-Beamte sagen, dass der Hauptgrund für den Rückzug darin besteht, Chinas wachsende militärische Macht und Selbstbehauptung zu bekämpfen. Sie argumentieren, dass die Vereinigten Staaten konventionelle bodengestützte Mittelstreckenraketen (GBIRs) gegen China einsetzen müssen - Systeme, die der INF-Vertrag den Vereinigten Staaten verbietet. Und da Peking dem Vertrag nicht beigetreten ist, hat die Volksbefreiungsarmee (People's Liberation Army, PLA) einen enormen Vorteil, argumentieren Beamte.“ (Übersetzung). In diesem Sinne und aus gleicher Quelle (Carnegie Endowment) auch ein Gastbeitrag in der FAZ.
In der Hauptsache hatte die amerikanische Kündigung des INF-Vertrages somit den Grund, Mittelstreckenraketen gegen China aufstellen zu können.
Schon bei Auslaufen des INF-Vertrages in 2019 gab es die Pläne, ein solches Konzept – nach der anfänglichen Fokussierung auf den „Kriegsschauplatz“ Indo-Pazifik - auch in Europa umzusetzen. „Obwohl die Multi-Domain Task Force in Europa erst am Anfang ihrer Entwicklung steht, wird erwartet, dass sie der US-Armee dabei helfen wird, ihre Doktrin für mögliche Bodenkampagnen gegen den Beinahe-Konkurrenten Russland zu entwickeln.“
Im Kern ist es somit nicht so, dass die neuen Mittelstreckenraketen in Deutschland aufgestellt werden, weil Russland mit seinen Iskander-Raketen den INF-Vertrag verletzt hat. Sondern umgekehrt: der INF-Vertrag wurde von den USA gekündigt, um solche Mittelstreckensysteme aufstellen zu können!
Nach dem Auslaufen des INF-Vertrages wurde von russischer Seite erklärt, sie würde sich weiter an die Bestimmungen des Vertrages halten, sofern nicht von amerikanischer Seite Mittelstreckenraketen auf dem europäischen Boden stationiert würden. Um die notwendige Transparenz zu gewährleisten schlug sie im Oktober 2020 ein gemeinsames Überprüfungsverfahren für die damals fraglichen Systeme vor: für die Iskander 9M729 in der Kaliningrad-Region, die nach US-Vorwürfen größere Reichweiten als 500 km haben soll; und für das Aegis Ashore Raketenabwehrsystem in Rumänien, bei dem Russland speziell den Launcher K-41 als potentielle Startvorrichtung für Marschflugkörper sieht.
Von den USA wurde dieser Vorschlag nicht aufgegriffen.
Als Antwort auf die viel weitergehende russische Forderung nach militärischer Neutralität der Ukraine hatte das Angebot damals allerdings praktisch keine Chance.
Das Angebot könnte aber perspektivisch wieder ein Anknüpfungspunkt sein für Verhandlungen mit dem Ziel, die Stationierung neuer US-Raketen zu verhindern und weiterhin – gerade auch gestützt über Transparenz- und Kontrollmaßnahmen Europafrei von landgestützten Mittelstreckenraketen zu halten. (Dass es see- und luftgestützte Systeme mit solcher Reichweiten gibt, die nicht unter den INF-Vertrag fielen, steht auf einem anderen Blatt.)
Festzuhalten ist jedenfalls: Jeder, der auf die Bedrohung durch die russischen Iskander-Raketen verweist, sollte wissen, dass es hinreichende Chancen gab, sie von vorneherein zu verhindern – Chancen, die von der NATO nicht genutzt und von den USA zunichte gemacht wurden!
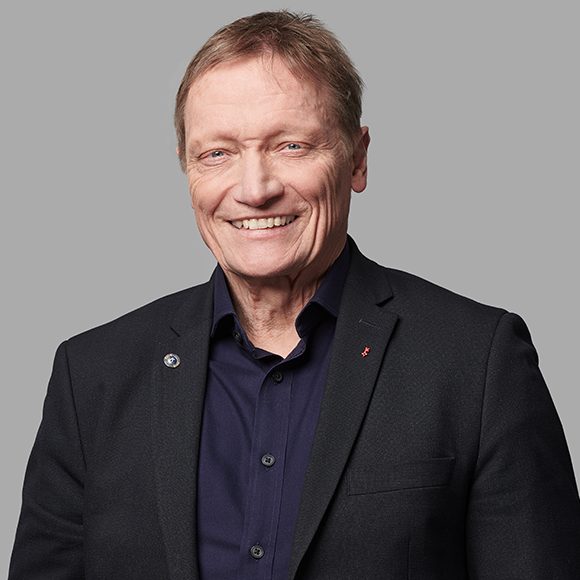
über den Autor
Arno Gottschalk ist Mitglied der Bremischen Bürgerschaft und haushalts- und finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag der Freien Hansestadt Bremen.

EGON BAHR
In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt.

Überlegenheit und Siegfähigkeit durch Geschwindigkeit, Reichweite und Integration – Die „Multi-Domain“-Doktrin hinter den neuen US-Raketen
von Arno Gottschalk
Die geplante Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stellt weit mehr dar als nur die Einführung neuer Waffensysteme mit größerer Reichweite. Sie ist Teil einer umfassenden strategischen Neuausrichtung der US-Armee, die darauf abzielt, durch modernste Technologien Positions- und Fähigkeitsvorteile zu gewinnen, um in der Frühphase eines Krieges schnell die Oberhand zu gewinnen.
Erhard Eppler

Wenn ein Konservativer etwas nicht versteht, dann ist das linke Ideologie. Und insofern war ich ein linker Ideologe.
Erklärung des Erhard-Eppler-Kreises
vom 27. Juli 2024
Wir, die Mitglieder des Erhard-Eppler-Kreises, sind tief besorgt über die Schlagseite, mit der gegenwärtig über Pro und Contra einer Stationierung von US-Langstreckenraketen in Deutschland und Wege zu einem Ende des Blutvergießens in der Ukraine debattiert wird.
Der Großteil der medial verbreiteten Einschätzungen geht davon aus, dass ein Waffenstillstand in der Ukraine und der Schutz Europas vor Putins imperialistischem Streben nur durch Abschreckung und gegenwärtig ohne damit einhergehende Aufforderung zum Eintritt in Abrüstungsverhandlungen gelingen kann.
Als Demokraten respektieren wir diese Position. Zu einem demokratischen Ringen um den richtigen Weg gehört aber auch, dass auch unsere und von vielen geteilte gänzlich andere Einschätzung respektiert wird.
Wie Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, warnen wir eindringlich davor, die Gefahren einer Stationierung von Langstreckensystemen mitten in Europa zu unterschätzen.
Es geht um nicht weniger als um die Frage, ob unser dicht besiedeltes Land zum Ziel eines atomaren Erstschlags werden könnte - eine Frage, die auch die glühendsten Befürworter dieser Art von Abschreckung nicht definitiv ausschließen können. Dessen ungeachtet wird Kritik - in der Sache ebenso wie in Bezug auf das Zustandekommen der Entscheidung und ihre Kommunikation - entweder totgeschwiegen oder in einer Weise herabgesetzt, die mit dem Stil einer demokratischen Debatte nicht in Einklang steht.
In der veröffentlichten Meinung wird der Eindruck erweckt, dass nur diejenigen „erwachsen“ und Experten seien, die allein auf Abschreckung mit ausschließlich in Deutschland stationierten Lenkwaffen großer Reichweite setzen. Zugleich wird das Plädoyer, „abseits des Schlachtfelds Wege zu einem Ende der Kämpfe“ zu suchen (Mützenich) als Aufruf von Träumern diskreditiert, die weiße Flagge zu hissen und dafür die Knechtschaft Putins in Kauf zu nehmen. Das ist ein inakzeptabler Umgang miteinander.
Wer die Suche nach Wegen abseits des Schlachtfeldes ausschließt, muss erklären, wie er einen Krieg beenden will, ohne das Schlachtfeld auszuweiten. Der Glaube, Raketenbasen der NATO blieben davon unberührt, wird jedenfalls von Beobachtern in Frage gestellt, die mit Fug und Recht den Titel „Experte“ für sich in Anspruch nehmen können.
Was uns befremdet ist das Schweigen der Führungen von SPD und SPD-Bundestagsfraktion zu der von Rolf Mützenich angestoßenen Debatte. Wir erleben tagtäglich nicht nur an der sozialdemokratischen Parteibasis, wie vielen Rolf Mützenich aus der Seele spricht.
Wir erwarten auch von der Führungsebene der Partei und der Fraktion, Farbe zu bekennen und den Fraktionsvorsitzenden gegenüber abqualifizierenden Vorwürfen zu verteidigen. Und wir würden uns von der Parteispitze gegenüber den Medien mehr sichtbaren Einsatz dafür wünschen, dass kontroverse Positionen in der Stationierungsfrage ohne Vorverurteilung einer Seite fair gegenübergestellt werden. Auch Schweigen ist eine Meinungsäußerung.
Unterzeichner für den Leitungskreis
- Dr. hc. Gernot Erler
- Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker
- Dr. Norbert Walter-Borjans
- Axel Fersen
- Cay Gabbe
- Albrecht Bregenzer
- Herbert Sahlmann
Über den Erhard-Eppler-Kreis „Frieden 2.0“
Der Erhard-Eppler-Kreis "Frieden 2.0" ist ein politischer Arbeitskreis, den Erhard Eppler noch kurz vor seinem Tod ins Leben gerufen hat. Er entstand aus Sorge über die Gefahren, die durch die Aufkündigung des INF-Vertrags durch die USA im Jahr 2019 entstanden sind. Der Kreis führt das Erbe von Erhard Eppler fort, organisiert Veranstaltungen, arbeitet mit Institutionen zusammen und fördert den Dialog mit politischen Entscheidungsträgern mit dem Ziel, die Mechanismen des Friedens verständlich zu machen.
Erhard Eppler (1926-2019) war ein deutscher SPD-Politiker, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit (1968-1974), Bundestagsabgeordneter (1961-1976), Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg (1976-1982), SPD Landesvorsitzender von Baden-Württemberg (1973 - 1981), Vorsitzender der SPD-Grundwertekommission (1973 - 1992), langjähriges Mitglied im SPD-Bundesvorstand und im SPD-Präsidium. Erhard Eppler war eine bedeutende Persönlichkeit der Friedensbewegung der 1980er Jahre, zudem 1983 Präsident des Kirchentages der EKD.
Erklärung des Vorstandes des Willy Brandt Kreises zur geplanten Stationierung von US-amerikanischen Langstreckenwaffen, 31. Juli 2024
Es ist sehr zu begrüßen, dass der Erhard-Eppler-Kreis die Diskussion über die geplante Stationierung von konventionell bestückten Langstreckenwaffen in Deutschland eröffnet hat. Wir unterstützen die Impulse des Kreises für eine vertiefte Diskussion der Problematik nachdrücklich.
Die bilaterale Vereinbarung zwischen der deutschen und der US-amerikanischen Regierung zur Stationierung landgestützter Mittelstreckenwaffen mit einer Reichweite von bis zu 3000 km darf nicht aus der Exekutive heraus getroffen werden. Es braucht eine ausführliche, tiefgehende Diskussion in unserem Land, im Parlament, in den Parteien und auch innerhalb der NATO Mitgliedsstaaten sowie konzeptionelle Erklärungen.
Zu den Argumenten, die in diesen Abwägungsprozess für eine dauerhafte Stationierung einbezogen werden müssen, gehören folgende:
- In der gemeinsamen Erklärung des Washingtoner NATO-Gipfels ist kein Bezug auf die bilaterale Vereinbarung zwischen der deutschen Regierung und der US-amerikanischen Regierung enthalten. Die bilaterale Vereinbarung bedeutet deshalb eine Singularisierung Deutschlands in Europa, da die Risiken der Stationierung nicht von den europäischen Partnern geteilt werden. Deutschland würde zu einem vorrangigen Ziel russischer Raketenangriffe.
- Die Stationierung landgestützter Langstreckenwaffen hat das Potenzial von deutschem Boden aus auch Ziele von strategischer Bedeutung Russlands anzugreifen.
- Gegenüber bereits vorhandenen see- und luftgestützten Systemen werden die verbleibenden Warnzeiten teilweise drastisch verkürzt. Dies bedeutet ein hohes Risiko von Fehlwahrnehmungen und Fehlreaktionen – mit möglicherweise katastrophalen Folgen.
- So lange es keine umfassende Abrüstung gibt, wird man auf Abschreckung nicht verzichten können. Mit dieser Feststellung kann aber nicht jede Rüstungsmaßnahme automatisch gerechtfertigt werden.
Ob sich angesichts der vorhandenen luft- und seegestützten Fähigkeiten von konventionellen Präzisionsflugkörpern der NATO wirklich eine Erhöhung des Abschreckungseffekts durch neue, landgestützte Langstreckenwaffen ergibt, ist umstritten. Aber selbst wer die Notwendigkeit von neuen Systemen behauptet, muss die dramatischen Risiken, die damit verbunden wären, wie z.B. eine verstärkte nukleare Bedrohung durch Russland, deutlich machen und abwägen.
Uns besorgt vor allem, dass in den Plänen in keiner Weise reale Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie es zu notwendigen Gesprächen und Vorschlägen zu gangbaren Rüstungskontrollschritten kommen kann. Die Gefahr ist akut, dass es zu einem neuen, teuren und gefährlichen Rüstungswettlauf auf Seiten der NATO und Russlands kommt und die nukleare Bedrohung zudem gesteigert wird.
Das müssen wir mit allen politischen Möglichkeiten verhindern. Wir benötigen stattdessen neue Impulse für internationale Zusammenarbeit, damit die drängenden Krisen der Welt angepackt werden und nicht enorme Ressourcen in ein erneutes Wettrüsten fließen. Der UN-Zukunftsgipfel, der im September 2024 in New York stattfindet, sollte ein solcher äußerer Anlass sein.
Öffentliche Unterstützerliste
Wir erhalten derzeit eine Vielzahl von Nachrichten von Unterstützern, die sich gerne öffentlich zu unserer Erklärung vom 27. Juli bekennen möchten.
Unterstützer aus dem Erhard-Eppler-Kreis
- Antretter, Robert, MdB a.D.
- Causemann, Klaus
- Erler, Dr. hc. Gernot, Vorsitzender
- Bregenzer, Albrecht
- Dieterich, Paul, Prälat i.R.
- Fersen, Axel
- Gabbe, Cay
- Helber, Roland
- Lieven, Alexander
- Wolfgang Brinkel
- Sahlmann, Herbert
- Walter-Borjans, Dr. Norbert, Finanzminister NRW a.D.
- von Weizsäcker, Prof. Ernst Ulrich, Vorsitzender
Unterstützer aus der Öffentlichkeit
- Ralf Stegner, MdB
- Michael Müller, MdB
- Dr. Carsten Sieling, MdB a.D.
- Bärbel Dieckmann, Oberbürgermeisterin a.D.
- Willi Lemke, Senator a.D.
- Heide Lemke
- Dietrich Lemke
- Anke Brunn, Staatsministerin a.D.
- Dr. Axel Berg, MdB a.D.
- Dr. Dr. h.c. Arne Clemens Seifert, Botschafter a.D.
- Golnar Sepherina
- Prof. Dr. Heinz Stapf-Finé
- Frank Schmiedchen
- Dr. Wolfgang Lieb, Staatssekretär a.D.
- Manuel Baumert
- Rahr, Alexander
- Hans Becker
- Gerhard Ballewski, RD a.D.
- Christoph Bayer, MdL a.D.
- Dagmar Wepprich-Lohse
- Christoph Marischka
- Susanne Fersen
- Christoph Habermann, Staatssekretär a.D.
- Helmut Schöpflin
- Prof. Dr. Gerhard Brunn
- Iris Lederer
- Prof. Dr. Christoph Zöpel, Staatsminister a.D.
- Ingrid Hentzschel
- Miguel Fersen
- Michael R.H. Phelps
- Arno Gottschalk, MdL
- Dr. Ute Finckh-Krämer, MdB a.D.
- Christian Wolff, Pfarrer i.R.
- Frank Schurgast
- Dr. Alexander Neu, MdB a.D.
- Stefan Michel
- Gunnar Eisold, MdL a.D.
- Gerd Pflaumer
- Reinhold Wetjen
- Stefano Jardella
- Klaus Peter Lohest
- Wolfgang Jüttner, Minister a.D., Hannover
- Dr. Daniel Engert
- Friedhelm Hilgers, Bundesvorstand SPD AG 60plus
- Hans-Dietrich Pallmann
- Dr. Günter Bonnet
- Wolfgang Biermann, Mitarbeiter von Egon Bahr
- Dieter Seipp
- Ernst F. Jochum, Pfarrer i.R.
Initiativen die die Erklärung unterstützen
- Mahnwache für Frieden Lüchow-Dannenberg
info@erhard-eppler-kreis.de
